Der Fachausschuss Dichtheitsprüfung und der Unterausschuss Ausbildung Lecksuche erkundeten die Schnittstellen zwischen Industrie und Wissenschaft bei einer Exkursion zu Pfeiffer Vacuum und dem CERN. Im Fokus standen innovative Methoden der Lecksuche, Herausforderungen der Vakuumtechnik und deren essenzielle Rolle in der Teilchenphysik. Einblicke in modernste Fertigungsprozesse, faszinierende Forschungseinrichtungen und hochpräzise Prüfverfahren machten die Reise zu einem einzigartigen Erfahrungsaustausch.
Wie eng industrielle Präzision und wissenschaftliche Forschung miteinander verknüpft sind, zeigte eine Exkursion des Fachausschusses Dichtheitsprüfung und des Unterausschusses Ausbildung Lecksuche (LT). Fünf Vertreter beider Ausschüsse besuchten die Firma Pfeiffer Vacuum in Annecy sowie das CERN in Genf und erhielten faszinierende Einblicke in die Welt der Vakuumtechnik und der Teilchenphysik.
Von neuesten Entwicklungen in der Lecksuche mit Wasserstoff bis hin zu den extremen Anforderungen der Antimaterieforschung – die Reise verdeutlichte, wie unverzichtbar höchste Dichtheit und präzise Prüfverfahren für Industrie und Wissenschaft sind. Die gewonnenen Erkenntnisse bieten wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung der Dichtheitsprüfung und die Ausbildung im Bereich Lecksuche.
Annecy: Präzision und Zukunftsthemen der Dichtheitsprüfung
Erste Station der Exkursion war die Firma Pfeiffer Vacuum in Annecy, einem Standort eingebettet in eine malerische Umgebung nahe der französisch-schweizerischen Grenze. Hier erwartete die Teilnehmenden ein intensiver anderthalbtägiger Austausch mit den Fachkräften des Unternehmens.
Diskutiert wurde unter anderem die Nutzung von Wasserstoff als Alternative zum bewährten Prüfgas Helium – ein Thema, das die Zukunft der Dichtheitsprüfung prägen könnte.
Neben den Fachgesprächen boten zwei Werksführungen faszinierende Einblicke in die Fertigungsprozesse von Pfeiffer Vacuum. Die Teilnehmenden konnten die Herstellung von Turbomolekular- und Wälzkolbenpumpen sowie Leckdetektoren aus nächster Nähe verfolgen. Besonders beeindruckend war die Präzision und Sorgfalt, mit der jedes Bauteil gefertigt und montiert wird – fast wie bei einem Schweizer Uhrwerk, in dem jedes Zahnrad perfekt ineinandergreift.
Ein weiteres wichtiges Thema war die Aus- und Weiterbildung im Bereich der Dichtheitsprüfung. Im Austausch mit der Schulungsabteilung PV Academy wurde das Potenzial für eine verstärkte Zusammenarbeit erörtert. Dabei entstand die Idee, gemeinsam an verbesserten Trainingskonzepten zu arbeiten – ein Vorhaben, das sowohl der Industrie als auch den Fachleuten der ZfP zugutekommen könnte.
CERN: Wo das Universum greifbar wird
Nach den Einblicken in die industrielle Vakuumtechnologie ging die Reise weiter nach Genf zum CERN, dem größten Forschungszentrum für Teilchenphysik weltweit. Der zweieinhalbtägige Aufenthalt bot den Exkursionsteilnehmern die Gelegenheit, sich aus erster Hand über die wissenschaftlichen und technischen Herausforderungen dieser einzigartigen Einrichtung zu informieren.
Die Fachkräfte am CERN – Physiker, Ingenieure und Techniker – beeindruckten nicht nur durch ihr enormes Fachwissen, sondern auch durch ihre Begeisterung für die Forschung. Besonders auffällig war die Offenheit der Einrichtung: Alle wissenschaftlichen Daten werden veröffentlicht, militärische Nutzung ist ausgeschlossen, und selbst Fotografieren ist fast überall erlaubt – eine Transparenz, die in dieser Form selten ist.
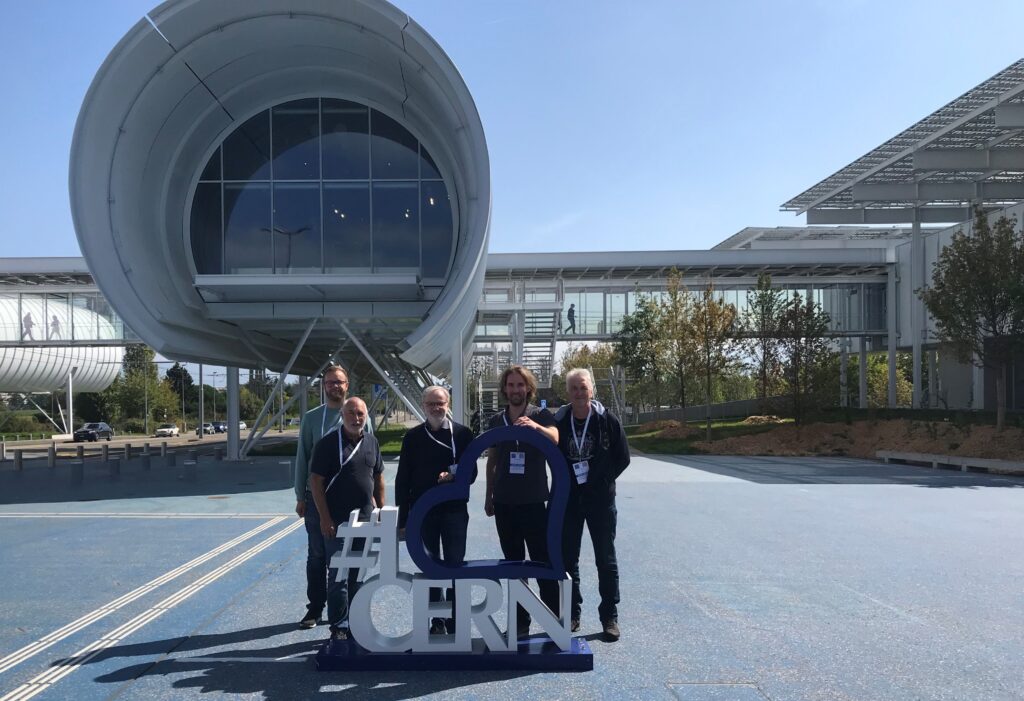
Vertreter des Fachausschusses Dichtheitsprüfung vor dem Besucherzentrum des CERN.
Der Large Hadron Collider – Wissenschaft im Grenzbereich
Ein Höhepunkt des Besuchs war die Einführung in die Funktionsweise des Large Hadron Colliders (LHC). Dieser größte Teilchenbeschleuniger der Welt beschleunigt Protonen auf 99,9999991 % der Lichtgeschwindigkeit, um fundamentale physikalische Prozesse zu untersuchen.
Ein anschaulicher Vergleich verdeutlichte die unglaublichen Energien, die hier im Spiel sind: Während ein einzelnes Proton im LHC die Energie eines fliegenden Moskitos besitzt, entfalten alle Protonen zusammen die Wucht einer Boeing 747 mit 1000 km/h.
Die Strahlen im LHC bestehen aus 2800 Paketen mit jeweils 100 Milliarden Protonen, die durch Strahlröhren mit einem Vakuum von 10⁻⁹ mbar rasen – ein Druck, wie er auf der Mondoberfläche herrscht.
Die Kollisionen erfolgen 40 Millionen Mal pro Sekunde unter anderem am Detektor CMS (Compact Muon Solenoid), wo beispielsweise das Higgs-Boson nachgewiesen wurde – eine Entdeckung, die durch das Schwesterexperiment ATLAS bestätigt wurde. Die enormen Datenmengen werden bereits fünf Meter vom Kollisionspunkt entfernt in einem parallelen Tunnel verarbeitet. Insgesamt speichert das CERN über 1,5 Millionen Terabyte an Daten, was 3400 Jahren ununterbrochenem hochauflösenden 4K-Streaming entspricht.
Die „Antimateriefabrik“ – Extreme Anforderungen an Dichtheit und Reinheit
Ein weiteres Highlight war die „Antimateriefabrik“. Hier werden Positronen und Antiprotonen zu Antiwasserstoff kombiniert – ein Prozess, der immense technologische Herausforderungen mit sich bringt.
In einem speziellen Behälter, der 24 Antiwasserstoff-Atome drei Jahre lang stabil hielt, wird der Druck auf 10⁻¹⁹ mbar geschätzt – ein Vakuum, das sogar noch geringer ist als im interstellaren Raum. Der vielleicht leerste Ort im Universum. Diese extremen Bedingungen stellen höchste Anforderungen an Dichtheit, Reinheit und Messgenauigkeit – Themen, die eine direkte Verbindung zur industriellen Praxis der Dichtheitsprüfung herstellen.
Zwei zusätzliche Führungen ermöglichten den Teilnehmenden Einblicke in die Bauteilassemblierung und die Prüfabteilungen des CERN. Besonders spannend war die Anwendung von Vakuummessungen, Restgasanalysen und Dichtheitsprüfungen, die entscheidend für die Funktion der Experimente sind.
Forschung mit Auswirkungen auf den Alltag
Die am CERN durchgeführte Forschung reicht weit über die Grundlagenphysik hinaus: Ohne die Entwicklungen am CERN gäbe es weder das World Wide Web noch Flashspeicher in Smartphones. Auch in der Medizin sind die Auswirkungen deutlich spürbar – beispielsweise durch die am CERN entwickelten Radioisotope für die Nuklearmedizin, die neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnen.
Am letzten Tag der Exkursion vertieften Fachvorträge von Julian Schulte-Steffens zur DGZfP und zur Ausbildung LT sowie von Dr. Rudolf Konwitschny zur Lecksuche am KATRIN-Experiment das gegenseitige Verständnis und den fachlichen Austausch.
Ausblick: 10. Fachseminar Dichtheitsprüfung im September 2025
Die Exkursion zeigte eindrucksvoll, wie eng industrielle Präzision und wissenschaftliche Forschung miteinander verbunden sind. Wer sich weiter mit den neuesten Entwicklungen der Dichtheitsprüfung auseinandersetzen möchte, sollte das 10. Fachseminar Dichtheitsprüfung am 23./24. September 2025 in Dortmund nicht verpassen.
Dort treffen sich Expertinnen und Experten aus Forschung, Industrie und Lehre, um aktuelle Themen der Dichtheitsprüfung zu diskutieren. Neben zahlreichen Fachvorträgen bietet das Seminar eine Geräteausstellung sowie vielfältige Möglichkeiten zum fachlichen Austausch und Networking.

📌 Hier geht’s zur Anmeldung für das Fachseminar 2025: Anmeldung
Interessierte haben noch bis 31. März 2025 die Möglichkeit, eigene Beiträge einzureichen und aktiv mitzuwirken.
📌 Beitrag einreichen bis 31. März 2025: Beitrag einreichen








